Verbraucherschutz im eCommerce
Mit dem zum 30. Juni 2000 in Kraft getretenen Fernabsatzgesetz wird der Verbraucherschutz für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen im Internet geregelt. Ab 1. April 2001 dürfen alte Kataloge nicht mehr verwendet werden.
Seit dem 30. Juni 2000 gilt das neue Verbraucherrecht für Fernabsatzverträge. Die neuen Vorschriften finden in der Praxis noch nicht die gebührende Beachtung.
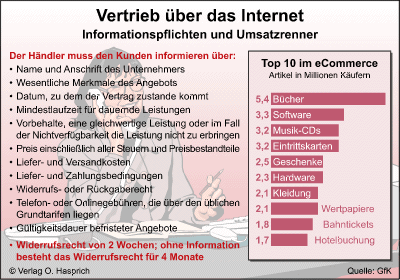
Wir geben folgende Hinweise:
-
Das Fernabsatzgesetz gilt für Verträge, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden. Hierunter sind Kommunikationsmittel zu verstehen, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste. Das Fernabsatzgesetz gilt also nicht, wenn vor dem Vertragsabschluß bereits persönlich Vertragsverhandlungen geführt worden sind, z.B. auf einer Messe. Nimmt z.B. ein Kunde auf einer Messe einen Kaufvertrag mit nach Hause, um sich den Kaufabschluss noch einmal gründlich zu überlegen und schickt er später den Kaufvertrag unterschrieben zurück, so ist der Kaufvertrag nicht unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln geschlossen worden, so dass das Fernabsatzgesetz keine Anwendung findet.
-
Außerdem gilt das Fernabsatzgesetz nicht, wenn der Vertragsabschluß nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt, also bei gelegentlichen telefonischen Bestellungen. Verwendet ein Unternehmer Bestellscheine, z.B. in Katalogen oder Werbeschreiben, so findet das Fernabsatzgesetz Anwendung, auch wenn von den Bestellscheinen nur gelegentlich Gebrauch gemacht wird. Das gleiche gilt, wenn der Unternehmer im Internet für seine Leistungen wirbt und es aufgrund dieser Werbung zu telefonischen oder schriftlichen Bestellungen kommt. In diesen Fällen handelt der Unternehmer im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebssystems.
Überlegen Sie daher, ob Sie in Ihrem Unternehmen weiterhin Bestellscheine verwenden wollen. Entscheiden Sie sich für eine weitere Verwendung von Bestellscheinen, so sollten Sie beachten, dass Sie bestimmte Informationspflichten zu erfüllen haben:
-
Identität und Anschrift des Unternehmers
-
Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung, sowie darüber, wann der Vertrag zustande kommt
-
Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat, z.B. Serviceverträge
-
Vorbehalte, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen oder die versprochene Leistung im Falle ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen, eine sinnvolle Klausel, die Sie davor schützt, eine nichtvorrätige Ware zu liefern
-
Den Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und sonstiger Preisbestandteile nach der neu gefassten Preisangabeverordnung
-
Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten
-
Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung
-
Widerrufs- oder Rückgaberecht
-
Kosten, die dem Verbraucher durch die Nutzung der Fernkommunikationsmittel entstehen, sofern sie über die üblichen Grundtarife, mit denen der Verbraucher rechnen muss, hinausgehen, z.B. die Schaltung von kostenpflichtigen Servicenummern
-
Die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises.
Alte Kataloge, die nicht diesen Vorschriften entsprechen, und die vor dem 1. Oktober 2000 hergestellt worden sind, können Sie noch bis zum 31. März 2001 aufbrauchen. Denken Sie daran: Sie müssen auch Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die neue Rechtslage anpassen.
Kernstück der Belehrungspflichten ist das Widerrufsrecht des Kunden. Diesem steht bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht von 2 Wochen zu. Wird der Verbraucher über das Widerrufsrecht nicht belehrt, so kann er das Widerrufsrecht 4 Monate lang ausüben. Anders als sonst bei Verbraucherverträgen muss der Kunde das Widerrufsrecht nicht unterschreiben. Die Widerrufsfrist beginnt bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim Kunden, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Tag des Eingangs der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor dem Tag des Vertragsabschlusses.
Das Widerrufsrecht kann durch ein Rückgaberecht ersetzt werden. Der Verkaufsprospekt muss eine deutlich gestaltete Belehrung über das Rückgaberecht enthalten. Das Rückgaberecht kann nur durch Rücksendung der Sache, deren Kosten und Gefahr der Unternehmer zu tragen hat, ausgeübt werden.
Abschließend ist noch ein wichtiger Warnhinweis angebracht: Durch die Lieferung unbestellter Sachen oder durch die Erbringung unbestellter sonstiger Leistungen durch einen Unternehmer an einen Verbraucher wird ein Anspruch gegen diesen nicht begründet. Sorgen Sie immer für eindeutige Verträge! Liegt Ihnen von dem Kunden nichts Schriftliches vor, so gehen Sie das Risiko ein, dass der Kunde behauptet, er habe die gelieferte Ware nicht bestellt. Besonders gefährlich sind daher telefonische Bestellungen. Verlangen Sie stets eine schriftliche Bestätigung von telefonischen Aufträgen. Bei unbestellten Waren hat der Kunde keine Sorgfaltspflichten, er ist nicht zur Aufbewahrung der Ware verpflichtet. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn der Kunde erkennen musste, dass der Verkäufer die Ware in der irrigen Vorstellung einer Bestellung lieferte.
Eine unbestellte Ware liegt nicht vor, wenn dem Verbraucher statt der bestellten eine nach Qualität und Preis gleichwertige Leistung angeboten und er darauf hingewiesen wird, dass er zur Annahme nicht verpflichtet ist und die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen hat. Damit Sie hier nicht unnötige Kosten auf sich nehmen, empfiehlt es sich vor der Auslieferung einer Ersatzlieferung, das Einverständnis des Kunden einzuholen.
Den kompletten Text des Fernabsatzgesetzes können Sie auch als PDF-Dokument abrufen: Fernabsatzgesetz vom 30. Juni 2000
Die neuesten 10 Top-News
Klicken Sie auf die einzelnen Beiträge um mehr zu erfahren:
- Beitragsbemessungsgrenzen 2026
- Regulärer Steuersatz für Einkünfte aus dem Krypto-Lending
- Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit
- Vom Arbeitnehmer getragene Stellplatzkosten
- Übersicht der Änderungen im Steuerrecht für 2026
- Anmietung eines Stellplatzes im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung
- Regelungen zum ermäßigten Steuersatz in der Gastronomie ab 2026
- Rückforderung einer zu Unrecht gewährten Energiepreispauschale
- Geldgeschenk zu Ostern kann schenkungsteuerpflichtig sein
- Neue Homeoffice-Regelung für Grenzpendler

